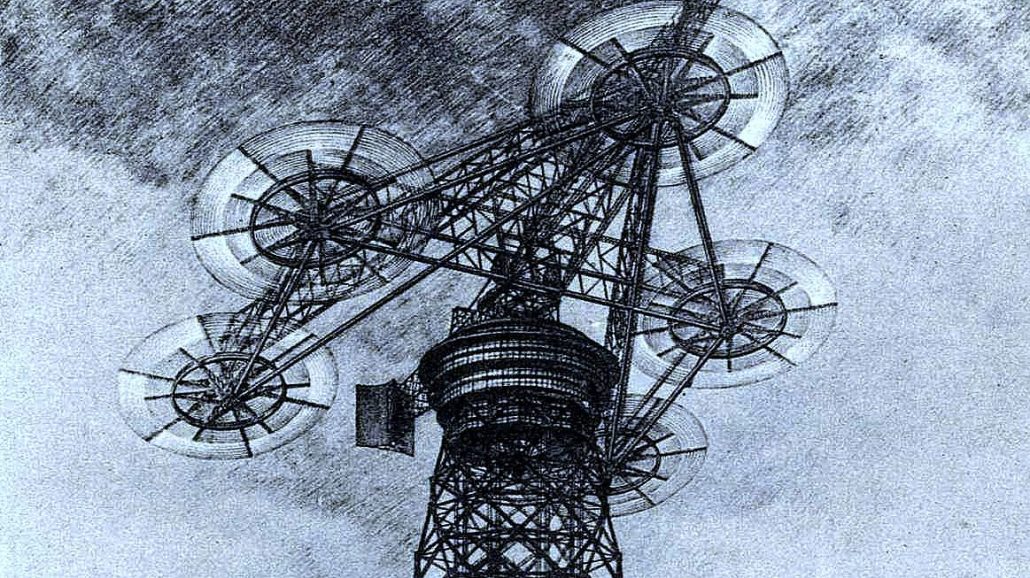Man kann es sich auch vorlesen lassen:
Drei Wortschöpfungen der Energiewende sind „Dunkelflaute“, „Versorgungslücke“ und „Brückentechnologie“. Die Dunkelflaute ist Schicksal, die Versorgungslücke ist Resultat des Pechs beim Denken und Brückentechnologie heißt, mit der Wurst nach dem Schinken werfen.
Deutschland hat 2025 knapp 20 Prozent bei der Umsetzung der Energiewende erreicht und schon bei der Stromerzeugung durch Wind und Sonne, die ja 2038 abgeschlossen sein soll, tauchen ganz erhebliche Schwierigkeiten auf, die daraus resultieren, dass es abends dunkel wird und gelegentlich ein paar Tage Windstille auftreten. Das konnte ja keiner ahnen. Bei Flaute und Dunkelheit kommt es nämlich nach dem Kernenergie- und Kohleausstieg zu einer sogenannten „Versorgungslücke“. Da man unverdrossen weiter Kohlekraftwerke zerstört, wächst die Stromlücke an. Solche Mengen Strom kann man auch nicht importieren, das schaffen die Grenzkuppelstellen nicht.
Man hatte bei der Konzeption der Energiewende irgendwie nicht daran gedacht, dass es bei Dunkelflauten noch Kraftwerke braucht und hat die existierenden feierlich und unter Jubel in die Luft gesprengt. Etwa die Hälfte ist schon weg. Weil es so schön war, möchte man gern an dieser Tradition festhalten. Nun müssen für die zerstörten und noch zu zerstörenden Kohlekraftwerke neue Gaskraftwerke gebaut werden, die man Brückentechnologie nennt, weil die nur bis 2045 ab und zu produzieren dürfen – bei Dunkelflauten. Wenn man dann 2045 über die Brücke am rettenden Ufer der erfolgreichen Energiewende angekommen ist, können die Brückengaskraftwerke auch noch gesprengt werden.
Jetzt entbrannte ein erbitterter Streit, ob – und wenn ja – wie viele Gaskraftwerke gebraucht werden. Je weniger jemand von Energieversorgung versteht, umso lauter führt er die Diskussion über die Energiepolitik. Fachleute werden längst nicht mehr gehört. Unter den Klängen des Bordorchesters bewegt sich die Energietitanic mit immer schnellerer Fahrt auf den Eisberg zu.
Deutschland wäre nicht das Land der Energiewende-Vorreiter, wenn nicht auch hierbei die Interessenvertreter der verschiedenen Macht- und Geldlobbys eine wilde Kakophonie aufführen und wie die Kesselflicker streiten würden, wie viele Gaskraftwerke es denn nun sein sollen. Auffällig ist, dass bei der Propagandaschlacht sichtbar wird, je weiter links sich ein Energiewender verortet, desto weniger Gaskraftwerke werden gebraucht. Echte Hardcore-Energiewender wie Claudia Kemfert brauchen gar keine. Wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint, dann regeln wir das mit „Bedarfsflexibilität“, dann brauchen wir eben keinen Strom. Das bedeutet aber nichts anderes als die Aufgabe des Konzeptes der „Netzsicherheit“. Wer braucht schon zu jeder Zeit Strom? Wenn eine Versorgungslücke entsteht, dann ist sie halt da.
Die Besserwissenden
Hauptzuständig für die Planung von Gaskraftwerken ist das Bundeswirtschaftsministerium, geführt von Katharina Reiche, mit der Bundesnetzagentur, geführt von dem Grünen Klaus Müller. Im Ministerium und der Netzagentur arbeiten 3.600 Beamte an Themen wie der Energieversorgung. Erforderliche Gaskraftwerke werden seit 2020 in den Versorgungssicherheits-Monitorings zum Thema. 2021 lag der Fokus noch stark auf Versorgungssicherheit und dem Kohleausstieg. Gaskraftwerke wurden als Übergangstechnologie erwähnt, aber kein klarer Neubau-Bedarf beziffert. 2022 wurde im Versorgungssicherheitsmonitoring erstmals ein konkreter Bedarf 17–21 GW an zusätzlicher steuerbarer Kapazität bis 2030 genannt. Hintergrund waren Absicherung der Energiewende und ein Ersatz für abzuschaltende Kohlekraftwerke. Im Jahre 2023 bestätigte der Monitoringbericht 2023 die steigende Bedeutung von Gaskraftwerken. Eine Prognose für 2025 und 2030 sollte „zeitnah“ veröffentlicht werden. Kapazität der bestehenden Gaskraftwerke lag 2022 bei 33,8 GW. 2024 wurde ein neues Versorgungssicherheitsmonitoring vorgelegt und ein Bedarf bis 2035 zwischen 22,4 GW (Zielszenario) und 35,5 GW (bei verzögerter Energiewende) prognostiziert. Nun lag die Betonung auf Flexibilisierung des Verbrauchs und Speichertechnologien, aber Gaskraftwerke blieben zentral. Der nächste Bericht der Bundesnetzagentur im September 2025 bestätigte die Spannbreite 22–35,5 GW bis 2035. 36 GW entspricht 71 neuen Gaskraftwerken à 500 MW.
Finnisch ist eine für uns Deutsche recht schwierige Sprache. Allerdings kennen die meisten Deutschen das finnische Wort für „Besserwisser“, ohne es zu ahnen. Dabei ist es ganz einfach: „Besserrwisserr“. Die Vorreitenden glauben fest daran, dass die Völker dieser Erde ihnen nacheifern werden, wenn sie erst erkennen, wie die deutsche Energiewende nicht nur das Weltklima rettet, sondern die deutsche Wirtschaft an die Weltspitze katapultiert.
Ganze Bataillone von Energieexperten erfinden täglich neue Wunderwaffen, um die immer größer werdende Versorgungslücke kleinzureden. Da schulte jüngst der ehemalige CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn zum Energieexperten der CDU um. Von Beruf ist er Bankkaufmann. Auch Professor Karl Lauterbach outete sich als SPD Experte für Energie und Klima. Der ist von Beruf Medizinökonom. Auch einige andere, mit wohlklingenden Professorentiteln bestückte Experten erklären mit Inbrunst, das mittels „Sektorenkopplung“ das Probledm auch ohne Kraftwerke gelöst werden kann. So zum Beispiel Professorin Claudia Kemfert, die in einer Gegendarstellung zu Vorwürfen in der Presse zu fragwürdigen Aussagen ihrerseits bezüglich der Gaskraftwerke behauptet: „Wir brauchen keine Brücken mehr; wir haben das rettende Ufer der erneuerbaren Energien längst erreicht.“ Ein anderer Professor namens Volker Quaschning will die Kohlekraftwerke länger laufen lassen – was durchaus Sinn macht –, die Gaskraftwerke mit Biogas betreiben oder durch Batterien ersetzen – was kapazitätsmäßig Unfug ist – und setzt auf „Flexibilität“ im Netz, das heißt, Strom gibt es, wenn die Sonne scheint und der Wind weht.
Eines eint all die Experten: Sie wissen besser als die dafür zuständigen Stellen, wie viele Gaskraftwerke benötigt werden. Die Regierungspartei SPD stimmt in den Chor der Besserwissenden ein und findet es „gut“, wenn jetzt nur zwanzig statt der nötigen 40 Kraftwerke gebaut werden, so der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Armand Zorn, der von Beruf ein Politikwissenschaftler ist: „Es ist gut, dass die Volumina jetzt auf einen für die Versorgungssicherheit realistischeren Wert reduziert werden.“ Die SPD hofft auf Batteriespeicher und „Netzflexibilität“. Sie fürchtet in Eintracht mit den grünen Umweltverbänden und der Erneuerbaren-Lobby, dass etwas von dem Energiewende-Geldsegen in andere Kanäle umgeleitet werden könnte. Mich würde mal interessieren, welche Bundestagsabgeordnete in Erneuerbare Aktien investiert haben? Sie streuen die Befürchtung, dass „dadurch die Energiewende zu Gunsten der Gaslobby abgewürgt würde“. Da trappst die Nachtigall aber gehörig. Ob die Energiewender dabei das Wohl des Landes im Sinne haben? Oder sind es nur Dilettanten, die ein Schneeballsystem, basierend auf dem Prinzip Hoffnung, betreiben? Immerhin führt eine Versorgungslücke zu unkontrollierbaren Strompreisen, Deindustrialisierung, Brownouts und womöglich zum Blackout mit allen furchtbaren Folgen.
Es wird bis 2030 gar kein neues Gaskraftwerk gebaut werden
Es gibt allerdings auch ein paar Protagonisten, die den Bedarf an Gaskraftwerken dramatisch höher einschätzen als das Bundesministerium. Der Umwelt-Thinktank Agora Energiewende – sicherlich über jedem Populismusverdacht stehend – hält 61 GW für nötig, das wären dann 122 Gaskraftwerke von je 500 MW. Die haben unterstellt, dass die ambitionierten Pläne der Großen Transformation realisiert werden und eine durchelektrifizierte Gesellschaft sich aufbaut. Der Bau so vieler Gaskraftwerke würde etwa 100 Milliarden Euro kosten. Eine Diskussion, wie viel Betriebskosten dies für den Steuerzahler verursachen würde, wird noch gar nicht geführt. Sie wäre auch sinnlos, da das LNG dafür gar nicht zur Verfügung steht
Da die vorgesehenen Gaskraftwerke im EEG-Gestrüpp als Lückenbüßer für die Volatilität der Erneuerbaren nicht wirtschaftlich betrieben werden, sollen sie auf Kosten der Steuerzahler als „Kapazitätsreserve“ subventioniert werden. Seltsamerweise muss so etwas von der EU „genehmigt“ werden. Die Bundesregierung plante 2025 eine Ausschreibung für 20 GW neue Kapazitäten zur Absicherung der Energiewende und stellte entsprechende Anträge bei der EU. Die EU-Kommission reduzierte dies auf 10 GW, da größere Mengen als Beihilfe kritisch gesehen werden, davon 8 GW neue wasserstofffähige Gaskraftwerke und 2 GW technologieoffen, z.B. Batteriespeicher oder andere flexible Lösungen. Maßgeblich zuständig für die Genehmigung neuer Gaskraftwerkskapazitäten in Deutschland ist auf EU-Ebene die EU-Kommissarin für Wettbewerb, Margrethe Vestager, eine Dänin von der Partei „radikale Venstre“ (Radikale Linke).
Damit wird die Bundesnetzagentur-Prognose ignoriert, dass bis 2035 22–36 GW neue steuerbare Kapazitäten gebraucht werden, um Kohleausstieg, Dunkelflauten und steigenden Strombedarf (Wärmepumpen, E-Mobilität) abzusichern. Es ist, als ob Deutschland sagt: „Wir brauchen 20 Feuerwehrwagen, sonst brennt die Stadt.“ Die EU antwortet: „Ihr dürft nur 10 Feuerwehrwagen kaufen – mehr wäre eine Wettbewerbsverzerrung.“ Wenn in der Folge in Deutschland die Hütten brennen – die Lichter ausgehen –, dann aber im Rahmen eines fairen europäischen Wettbewerbs.
Die Diskussion um die benötigte Kapazität der Gaskraftwerke erscheint Fachleuten recht obsolet, egal ob nun 12 oder 61 GW bis 2030 gebaut werden sollen. Denn es wird bis 2030 gar kein neues Gaskraftwerk gebaut werden. Deutschland verfügt aktuell über rund 30 GW installierte Gaskraftwerkskapazität. Und mehr wird es auch 2030 nicht geben, weil die politischen Kesselflicker sich nach wie vor um ein „Ausschreibungsdesign“ streiten. Die Investoren für die Gaskraftwerke warten seit vier Jahren auf das „Ausschreibungsdesign“. Die Frage steht im Raum – wer soll das bezahlen?
Die neuen Gaskraftwerke sollen nur laufen, wenn Wind und Sonne schwächeln. Das sind so um 1.400 Stunden im Jahr, das aber 8.760 Stunden hat. Also mit einer geplanten „Verfügbarkeit“ von 16 Prozent. Sie können also gar nicht rentabel arbeiten, da der Stillstand genauso viel kostet wie der Betrieb abzüglich des Brennstoff-Gases. Beim „Ausschreibungsdesign“ geht es um die Subventionen, mit denen der „Gaskraftwerks-Kapazitätsmarkt“ bezahlt wird. Nur wenn der Steuerzahler für die nächsten 15 Jahre die Kosten als „Anschubfinanzierung“ schultert, werden die Subventionsabgreifer Gaskraftwerke bauen. Danach „übernimmt der Markt“, sagen die Politiker und meinen, dass danach die Zusatzkosten über Netzentgelte oder Umlagen auf die Strompreise verteilt werden. Das heißt: Am Ende zahlen statt der Steuerzahler die Stromkunden die Kapazitätsprämien, ähnlich wie heute bei der EEG‑Umlage oder Netzentgelte. Liebe Leser, merken Sie etwas?
Die Wartezeit für eine Gasturbine liegt derzeit bei vier Jahren
Die Bundesregierung hat im Jahr 2025 den Neubau von bis zu 12 GW beschlossen, um Versorgungslücken nach dem Kohleausstieg zu schließen. Aber es gibt noch nicht einmal laufende Ausschreibungen – nur die politische Entscheidung. Die eigentlichen Ausschreibungen sollen 2026 beginnen. Danach sollen Genehmigungsverfahren beginnen und die Aufträge an die Hersteller vergeben werden. Sagen wir mal, im optimalen Falle dauert das drei Jahre. Dann können die Hersteller angefragt werden.
Da viele Länder gleichzeitig neue Gaskraftwerke planen (z.B. Vietnam, Indien), sind die Auftragsbücher voll. Die Wartezeit auf eine 500-MW‑Gasturbine liegt aktuell bei etwa vier Jahren, abhängig von Hersteller, Projektgröße und Lieferketten. Große Gasturbinen der 500-MW-Klasse gehören zu den komplexesten Industrieprodukten überhaupt. Hersteller wie GE Vernova, Siemens Energy oder Mitsubishi Power fertigen sie nur in wenigen spezialisierten Werken weltweit. Allein die Fertigung und Montage einer solchen Turbine dauert 12–18 Monate. Hinzu kommen Transport, Installation und Testbetrieb. Das führt zu Lieferzeiten von 24–48 Monaten. Hinzu kommen Lieferkettenprobleme. Nach der Pandemie und durch geopolitische Spannungen (z. B. Rohstoffengpässe, Logistikprobleme) verlängern sich die Wartezeiten. Und es geht ja nicht nur darum, eine Gasturbine in die Landschaft zu stellen, sondern um ein richtiges Gaskraftwerk. So ein 500-MW-Gasblock ist eine Großbaustelle. Auch zwei Großtransformatoren gehören zum Bauumfang. Die Wartezeit auf solche Transformatoren beträgt derzeit ebenfalls vier Jahre. Da ein Land nicht 50 oder 70 Kraftwerke gleichzeitig bauen kann, werden die letzten Gasblöcke eventuell kurz vor 2045 fertig.
Kurz gesagt – mit viel Glück und noch mehr Geld werden die ersten Gaskraftwerke Mitte der Dreißiger Jahre in Betrieb gehen. Die „Brückenterchnologie“ soll aber bis 2045 – also weniger als 10 Jahre nach ihrem Bau – entweder mit Wasserstoff laufen – den es nicht gibt und auch nicht geben wird, weil Deutschland bis dahin längst pleite ist – oder auch gesprengt werden.
Ein gutes Beispiel für das Gaskraftwerksdilemma ist das Gaskraftwerk Irsching in Voburg an der Donau in Bayern. Das Kraftwerk Ulrich Hartmann (Block 4) hat eine Leistung von 561 MW und ging 2011 in Betrieb. Mit einem Wirkungsgrad von 60,4 Prozent ist es eine der effizientesten GuD-Anlagen weltweit. Trotzdem wollten die Betreiber ihn mehrfach stilllegen, da er sich am Markt nicht rechnete. Die Bundesnetzagentur untersagte dies jedoch und stellte ihn als „systemrelevant“ unter Netzreserve. Der Block ist jetzt das, was die neuen Gaskraftwerke alle werden sollen. Die Betreiber erhalten eine vollständige Kostenerstattung für den Betrieb der Anlage, solange sie als Netzreserve vorgehalten wird: Fixkosten (Personal, Wartung, Instandhaltung), Betriebskosten (Brennstoff, wenn die Anlage tatsächlich eingesetzt wird) und Kapitalkosten (Abschreibungen, Finanzierungskosten). Die Kosten werden über die Netzentgelte auf die Stromkunden umgelegt – also letztlich von allen Verbrauchern bezahlt. Genaue Summen sind vertraulich, aber es werden so um 30 Millionen Euro pro Jahr für diesen einen Block sein.
Die Energiewende in ihrem Lauf, hält keine Dunkelflaute und Versorgungslücke auf. Das Ganze ist so grotesk, dass man es sich nicht ausdenken kann. Es werden munter und unverdrossen weiter die existierenden Kraftwerke zerstört. Von derzeit noch 44 GW Kohlekapazität (Braun- und Steinkohle zusammen) bleiben bis 2031 nur noch etwa 17 GW übrig. Das heißt: rund 27 GW Kohlekapazität sind bis dahin stillzulegen. Und für die wegzusprengenden Kraftwerke sollen neue Kraftwerke gebaut werden, die man kurz nach ihrer Fertigstellung dann auch wieder wegsprengen kann. Sollten tatsächlich 60 Blöcke gebaut werden, können sich die Deutschen im Jahr 2045 auf monatlich fünf Kraftwerkssprengungen mit Volksfestcharakter, Bier und Bratwurst freuen.