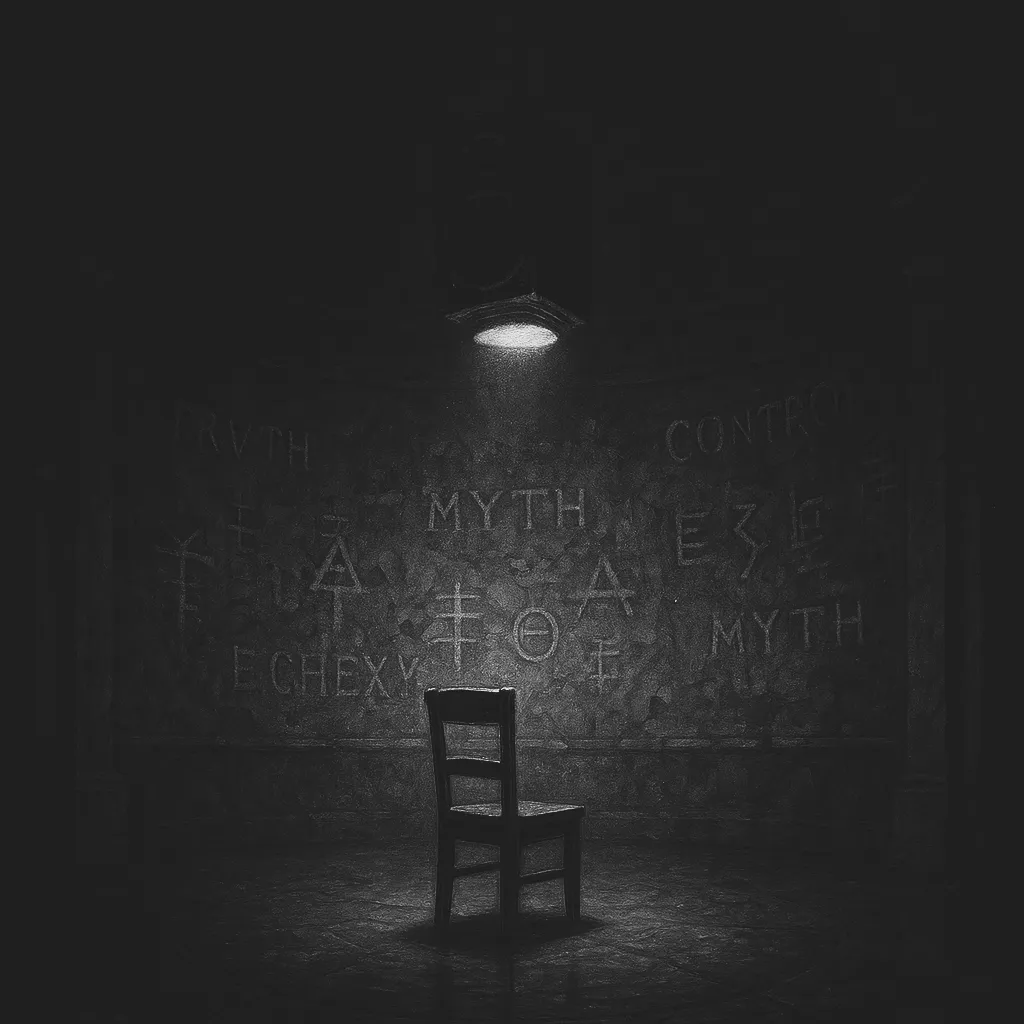Die Epstein-Affäre: Mossad-Gerüchte und der Vertrauensverlust
Teil III der Jussur-Reihe über Verschwörungserzählungen, öffentliches Vertrauen und den Zusammenbruch der Realität
„Je leiser die Akte, desto lauter die Fantasie.“
In Teil I haben wir untersucht, wie die Konflikte im Gazastreifen, die US-Politik gegenüber dem Iran und die anhaltende mangelnde Rechenschaftspflicht mächtiger Akteure ein Klima geschaffen haben, das Verschwörungserzählungen begünstigt. In Teil II haben wir die Entwicklung antisemitischer Konzepte – insbesondere des ZOG-Mythos – nachgezeichnet und untersucht, wie sich diese Konzepte an das digitale Leben und ideologische Überschneidungen angepasst haben. Nun, in Teil III, wenden wir uns dem Moment zu, in dem alles in den Mainstream gelangte: dem Fall Jeffrey Epstein.
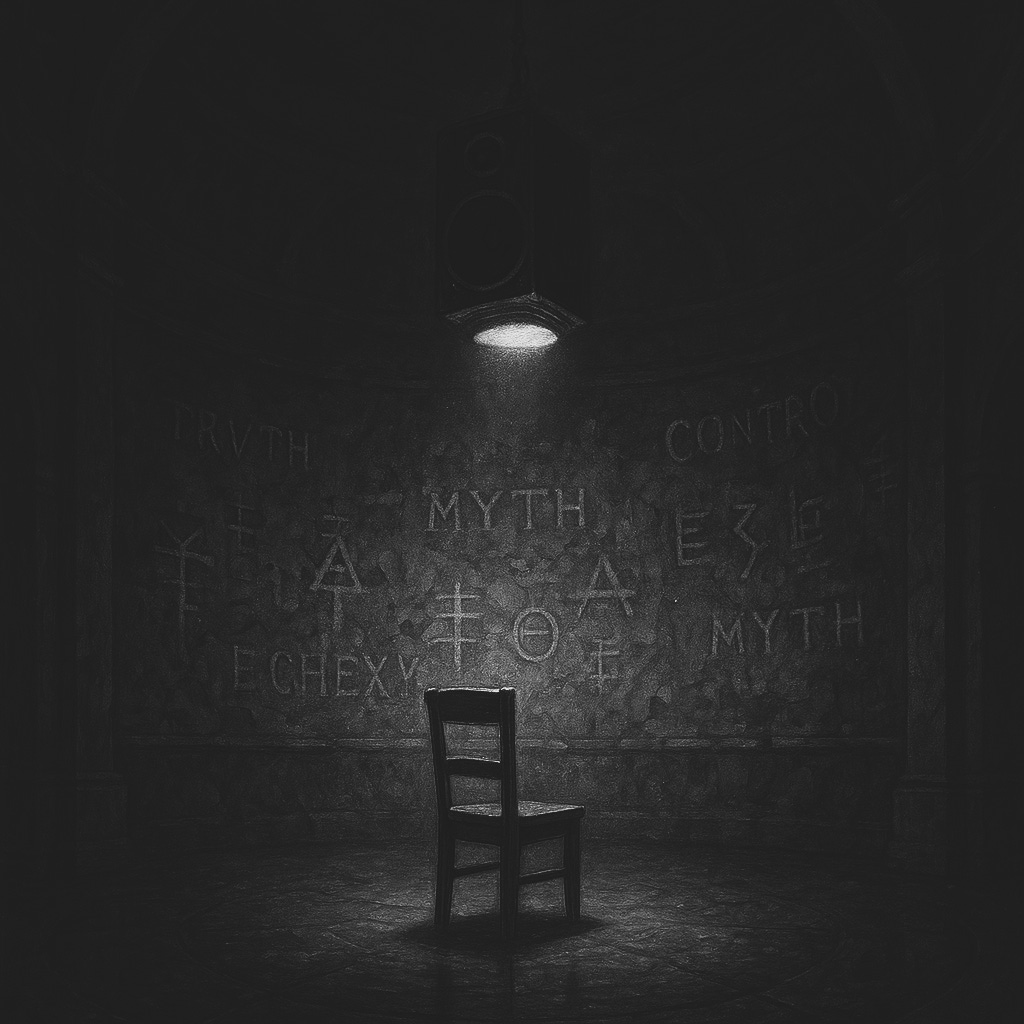
Der Vertrauensverlust beginnt mit einer Leiche
Jeffrey Epstein starb im August 2019 in einer Haftanstalt in Manhattan. Offiziell lautete das Urteil Selbstmord. Doch fast alles an dem Fall widersprach dem Vertrauen der Öffentlichkeit. Die Wärter waren angeblich eingeschlafen. Überwachungskameras im Flur fielen aus. Sein Zellengenosse war erst Stunden zuvor verlegt worden. Epstein, ein Mann, der als Hochrisikohäftling galt, wurde die ganze Nacht unbeaufsichtigt gelassen.
Die Fakten haben ein Vakuum geschaffen, das zu groß ist, um es zu ignorieren.
Bis Ende 2019 war der Satz „Epstein hat sich nicht umgebracht“ zu einer viralen Abkürzung für Misstrauen geworden. Er tauchte in Graffiti, auf Plakatwänden, in Interviews mit den Kabelnachrichten und in den sozialen Medien auf. Was als Misstrauen begann, wurde schnell zu einem kulturellen Phänomen. Nicht nur Verschwörungstheoretiker teilten den Slogan. Auch Veteranen, Komiker, Journalisten und Menschen aus dem gesamten politischen Spektrum waren dabei. Er wurde zu einer Art säkularem Dogma – ein Satz, den die Menschen nicht nur der Wirkung wegen wiederholten, sondern weil er das unaussprechliche Gefühl einfing, dass zwischen der Öffentlichkeit und den Institutionen, die einst moralische Autorität beanspruchten, etwas zerbrochen war.
Für viele Amerikaner war dies kein Randthema. Es war das erste Mal, dass ein öffentlicher Skandal alle seit langem gehegten Vermutungen über die Straflosigkeit der Mächtigen zu bestätigen schien.
Die Erpressungsnetzwerktheorie und ihre Implikationen
Was Epsteins Symbolstatus mehr als jedes andere Detail festigte, war die Art seiner Verbrechen. Epstein missbrauchte nicht einfach Minderjährige. Ihm wurde vorgeworfen, ein System organisiert zu haben, das minderjährige Mädchen dazu verleitete, sexuelle Handlungen für wohlhabende Gäste vorzunehmen. Viele dieser Interaktionen wurden Zeugenaussagen und Gerichtsakten zufolge aufgezeichnet. Seine Anwesen waren mit Überwachungsgeräten ausgestattet. In den Zimmern waren Kameras installiert. Viele glauben, dass Beweise archiviert wurden.
Die Vermutung war nicht, dass Epstein dies nur aus Vergnügen tat, sondern um Druck auszuüben. Er war nicht nur ein Raubtier, sondern auch ein Geheimnissammler. Die Idee setzte sich durch: Epstein führte eine Erpressungsoperation durch. Er besaß Tonbänder. Er besaß Akten. Er hatte die Macht, Leben zu zerstören. Aber was noch wichtiger war: Er genoss Schutz.
Dieser Schutz warf Fragen auf. Wer hat ihm das so lange gestattet? Wer profitierte von seinem Schweigen? Wer sorgte dafür, dass er 2008 mit einem Klaps auf die Finger davonkam? Und schließlich: Wer entschied, dass er 2019 nicht vor Gericht gestellt werden würde?
Die Erpressungsgeschichte ist so eindringlich, weil sie dem Ausmaß des Verbrechens entspricht. Ein einzelner Täter kann bestraft werden. Ein ganzes System nicht. Und Epsteins Überleben – so viele Jahre lang, trotz so vieler Warnungen – sah nicht nach einem Versagen aus. Es sah nach einer geplanten Tat aus.
Die Mossad-Vorwürfe und die globale Vorstellungskraft
Auf dieser Grundlage entwickelte sich eine ehrgeizigere Theorie. Es ging nicht nur um mächtige Freunde und gegenseitige Deckung. Es ging um Geheimdienstinformationen. Genauer gesagt um israelische Geheimdienste.
Die Theorie besagt, dass Epsteins gesamte Operation ein „Honeypot“ – ein klassischer Geheimdienstbegriff für eine sexuelle Falle – war, der darauf abzielte, die globale Elite zu kompromittieren und Einfluss im Namen einer staatlichen Behörde zu gewinnen. Am häufigsten wurde der Mossad beschuldigt. Die Gründe waren zwar umständlich, aber vielsagend.
Ghislaine Maxwell, Epsteins langjährige Vertraute und spätere Mitangeklagte, ist die Tochter von Robert Maxwell – einem britischen Medienmagnaten, dem seit langem Verbindungen zum israelischen Geheimdienst nachgesagt wurden. Er starb 1991 unter mysteriösen Umständen, nachdem er von seiner Jacht in der Nähe der Kanarischen Inseln gestürzt war. Er wurde in Jerusalem ehrenvoll bestattet, an seiner Beerdigung nahm die Elite der israelischen Sicherheits- und politischen Führung teil. Die Beziehung seiner Tochter zu Epstein veranlasste viele, die beiden Fälle zu verknüpfen.
Darüber hinaus unterhielt Epstein gut dokumentierte Beziehungen zu einflussreichen israelischen Persönlichkeiten, darunter zum ehemaligen Premierminister Ehud Barak, der lange nach Epsteins erster Verurteilung fotografiert wurde, als er Epsteins Haus in Manhattan betrat. Epsteins Terminkalender enthielt Treffen mit jüdischen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, von Akademikern wie Noam Chomsky bis hin zu Finanziers und Medienproduzenten. Keine dieser Verbindungen allein bewies irgendetwas. Doch für ein Publikum, das ohnehin schon auf den Verdacht verdeckter Kontrolle eingestellt war, bildeten diese Namen eine Konstellation.
Und dann kam der Wendepunkt. Im Jahr 2025 begann Tucker Carlson – der meistgesehene konservative Kommentator der USA – in Sendungen zu behaupten, Epstein habe Verbindungen zum israelischen Geheimdienst. Er fragte, warum Epsteins Auslandsbeziehungen, insbesondere zu Israel, nicht umfassend untersucht worden seien. Er betonte, das Aufwerfen solcher Fragen sei nicht antisemitisch. Doch die Implikation war unmissverständlich. Wenn ein Mann wie Carlson solche Behauptungen auf nationaler Ebene in die Welt setzen konnte, konnten sie nicht länger als Randerscheinung abgetan werden.
Für Verschwörungstheoretiker war dies eine Genugtuung. Die Mossad-Geschichte hatte es aus Foren und Telegram-Chats in den Mainstream-Diskurs geschafft.
Offizielle Dementis und ihre umgekehrte Wirkung
Die Gegenreaktion israelischer Behörden ließ nicht lange auf sich warten. Der ehemalige Premierminister Naftali Bennett wies die Vorwürfe öffentlich zurück und bezeichnete sie als gefährliche und haltlose Lüge. Er könne mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass Epstein nie für den Mossad gearbeitet habe. Er stellte die Vorwürfe als Fortsetzung antisemitischer Hetzkampagnen dar.
Aber so funktioniert Verschwörungslogik. Wenn ein mächtiger Beamter etwas zu energisch leugnet, fühlt es sich wie eine Bestätigung an. Wenn die Medien sich weigern, ernsthaft darauf einzugehen, fühlt es sich wie Schweigen an. Jede institutionelle Ablehnung wird zu einem Baustein in der Mauer des Glaubens.
Dieses Muster vertiefte sich, als das US-Justizministerium im Juli 2025 ein Memo veröffentlichte. Das Justizministerium erklärte, es existiere keine „Kundenliste“. Es gebe keine schlüssigen Beweise für ein größeres Netzwerk. Es bekräftigte, dass Epstein Selbstmord begangen habe. Das Verfahren wurde eingestellt.
Für die Gläubigen war dies keine Lösung, sondern eine Vertuschung.
Schweigen der Elite als Schuldbeweis
Der Fall Epstein führte zu einem Moment der Konvergenz. Rechte Verschwörungstheoretiker, linke Populisten, institutionelle Skeptiker und unabhängige Journalisten kamen alle zum gleichen Schluss: Die Wahrheit kommt nicht ans Licht.
Pam Bondi, Trumps Justizministerin, hatte zuvor die Veröffentlichung der Epstein-Akten versprochen. Sie hatte sogar Social-Media-Influencer eingeladen, kuratierte Beweise einzusehen. Doch diese Akten enthielten nichts. Die versprochenen Enthüllungen blieben aus. Als das Memo des Justizministeriums früheren Aussagen widersprach, verhärtete sich die Darstellung. Menschen, die Trump vertraut hatten, „den Sumpf trockenzulegen“, fühlten sich betrogen. Wenn nicht einmal Trump die Epstein-Dokumente freigeben würde, wem konnte man dann noch trauen?
Die Empörung überschritt ideologische Grenzen. Jack Posobiec warf der Regierung vorsätzliche Täuschung vor. Alex Jones bezeichnete den gesamten Fall als psychologische Operation. Elon Musk twitterte kryptisch und fragte, wie die Amerikaner einem Politiker vertrauen könnten, der die Epstein-Akten unter Verschluss hält. Er ging sogar noch weiter und unterstellte, Trump, Steve Bannon und andere Persönlichkeiten könnten in den unveröffentlichten Unterlagen selbst namentlich genannt werden.
Vor dem Gericht der öffentlichen Meinung klang das offizielle Schweigen wie ein Geständnis.
Der Mythos und der Mann: Epstein als Symbol
Jeffrey Epstein wurde zum Totem. Er war nicht länger nur ein Mensch. Er war eine Chiffre dafür, wie Macht funktioniert. Er wurde zur modernen Verkörperung jedes Geheimnisses, von dem die Öffentlichkeit glaubt, es sei vor ihr verborgen.
Er war Jude. Er hatte gute Beziehungen. Er starb in Haft. Er entging den Konsequenzen. Seine Opfer erfuhren nie Gerechtigkeit. Seine Verbündeten wurden nie entlarvt.
Für antisemitische Bewegungen war das perfekt. Epstein wurde zur Verkörperung der Protokolle. Für QAnon war er der Beweis, dass die elitäre pädophile Kabale real war. Für Skeptiker der westlichen Außenpolitik war er das Bindeglied zwischen zionistischem Einfluss und amerikanischer Korruption. Jede Ideologie fand in Epstein genau das, was sie brauchte.
Und die Tatsache, dass niemand erklären konnte, wie er so weit gekommen war, wie er starb und warum niemand namentlich genannt wurde, bestätigte nur, dass die Geschichte größer war, als irgendjemand zuzugeben wagte.
Die letzte Funktion der Epstein-Erzählung
In jedem Verschwörungssystem gibt es ein Schlüsselereignis. Epstein wurde zu diesem Ereignis. Nicht, weil alles an den Theorien wahr war, sondern weil genug davon wahr war. Sein Fall verband Spekulation und Beweise. Er ermöglichte es den Gläubigen zu sagen: „Das ist keine Theorie. Das ist passiert.“
Und weil keine vollständige Aufklärung erfolgte, breitete sich die Geschichte aus.
Es wurde eine Geschichte globaler Geheimdienstnetzwerke. Eine Geschichte zionistischer Kontrolle. Eine Geschichte der Straflosigkeit der Elite. Und sie erwies sich als noch wirkungsvoller, weil sie auf einer echten Leiche basierte, in einer echten Zelle, mit einer echten Liste unangeklagter Mitverschwörer, die die Welt nie zu Gesicht bekam.
In Teil IV widmen wir uns den nächsten Schritten. Wir untersuchen, wie Meme-Kultur, Influencer und algorithmische Radikalisierung diesen Vertrauensverlust als Waffe eingesetzt haben. Wir erforschen, wie Verschwörungserzählungen, wie sie der Fall Epstein hervorgebracht hat, heute nicht nur die individuelle Wahrheit, sondern die Struktur der demokratischen Gesellschaft bedrohen.