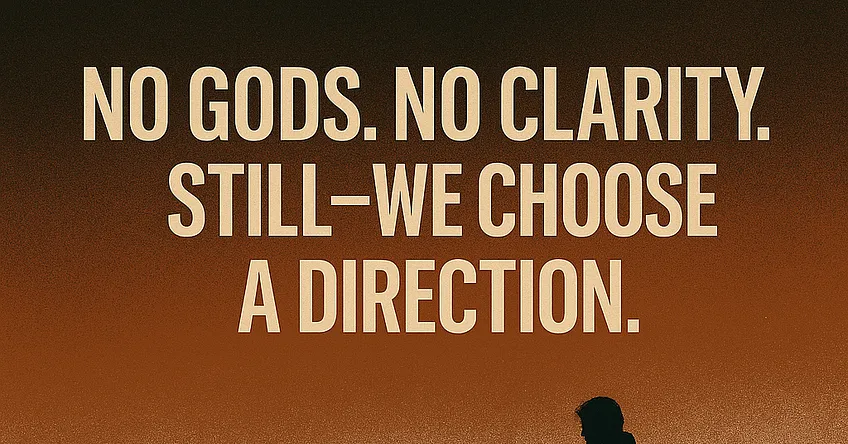Jussur
Als Donald Trump die Wahl 2024 gewann, war ich nicht schockiert. Ich war nicht wütend. Ich blieb gelassen.
Damals schrieb ich auf einer anderen Plattform, dass ich optimistisch blieb. Nicht, weil ich an Perfektion glaubte, sondern weil ich an Fortschritt glaubte. Dieser Glaube basierte nicht auf Institutionen oder Slogans. Er basierte auf der Idee, dass die Menschen klar sehen, wenn Illusionen zerbrechen. Wenn Propaganda zusammenbricht, kann etwas Ehrliches entstehen. Der Zusammenbruch kommt immer zuerst. Dann kommt die Abrechnung.
Heute ist diese Abrechnung im Gange.
Man versprach uns, dies sei eine neue Ära der Stärke. Amerika werde zu seiner alten Größe zurückkehren. Neue Handelsabkommen, eine härtere Rhetorik und wirtschaftlicher Nationalismus würden Jahrzehnte des Niedergangs umkehren. Doch die Slogans erwiesen sich als wirkungslos. „America First“ kehrte zurück – nicht als Politik, sondern als Leistung. Zölle wurden wieder eingeführt, die ausländische Konkurrenz erneut beschuldigt, und dieselben Konzernmächte prägten weiterhin still und leise die tatsächlichen Ergebnisse hinter den Kulissen.
An der Struktur änderte sich nichts wirklich. Die Reichen blieben geschützt. Das System belohnte weiterhin Konsolidierung statt Innovation, Profit statt Menschen. Amerikanische Arbeiter mussten sich weiterhin mit steigenden Kosten, stagnierenden Löhnen und einer politischen Klasse herumschlagen, die immer noch mit alten Phrasen von vor vierzig Jahren sprach.
Dieselben populistischen Botschaften, die den Schutz der Mittelschicht versprachen, änderten kaum etwas an der Entwicklung. Die Reichen wurden reicher. Die Öffentlichkeit wurde wütender. Und das Spektakel wurde lauter, um das Schweigen zu überdecken.
Doch es passiert noch etwas anderes: Die Illusion zerbricht.
Immer mehr Menschen begreifen, dass Slogans weder die Einkaufstüten füllen noch die Miete senken. Immer mehr Menschen erkennen, dass kein einzelner Politiker dieses im Grunde strukturelle Problem lösen kann. Sie beginnen zu verstehen, dass der amerikanische Traum nie eine Garantie war, sondern ein Verkaufsargument – eines, das nur für eine immer kleiner werdende Minderheit funktionierte.
Ich bin nicht nach Amerika gekommen, um einer Fantasie nachzujagen. Ich bin gekommen, um etwas Eigenes aufzubauen. Und neben den Möglichkeiten, die ich dort fand, stieß ich auch auf Widersprüche, die keine noch so harte Arbeit ausräumen kann. Erfolg schützt nicht vor der Wahrheit. Er offenbart sie.
Dieser Kreislauf ist nicht neu. In den 1980er Jahren propagierten Reagan und Thatcher den freien Marktfundamentalismus und behaupteten, die Menschen seien auf sich allein gestellt. Thatcher behauptete sogar, es gäbe so etwas wie eine Gesellschaft gar nicht. Was folgte, war eine Generation, die mit Individualismus und Angst aufwuchs. Dieselbe Logik wurde neu verpackt und durch den Nationalismus verkauft, nur dass diesmal nicht nur persönliche Verantwortung im Vordergrund stand, sondern Schuldzuweisungen. Schuld war der Außenseiter. Schuld war das System. Schuld war jeder, außer denen, die die Regeln schreiben.
Doch Schuldzuweisungen sind keine Strategie, sondern eine Ablenkung.
Und während die Ablenkungen anhalten, verschärft sich die Krise. Sie ist nicht nur wirtschaftlicher Natur. Sie ist emotionaler Natur. Sie ist moralisch. Die Menschen sind müde. Sie sind überarbeitet, unterbezahlt und bekommen das Gefühl, ihre Probleme seien persönliches Versagen. Die Burnout-Kultur ist zur Normalität geworden, und die Institutionen, die einst Vertrauen genossen, sind durch das Spektakel ausgehöhlt worden.
Dennoch bleibe ich hoffnungsvoll.
Denn sobald die Menschen aufhören, an die Illusion zu glauben, beginnen sie, bessere Fragen zu stellen. Sie beginnen, andere Antworten zu finden. Das Ende eines Mythos ist nicht das Ende eines Landes. Es ist der Beginn von etwas Ehrlicherem.
Fortschritt entsteht nicht durch Versprechungen. Er entsteht durch Druck. Durch aufmerksame Menschen. Durch diejenigen, die sich nicht mit Ästhetik statt Substanz zufrieden geben.
Dieser Moment wurde als Rückkehr zur Stärke dargestellt. Handelsabkommen wurden als Beweis verkauft. Die Erzählung behauptete, der amerikanische Einfluss sei zurückgekehrt, die Zölle würden wirken und ausländische Mächte würden endlich den amerikanischen Forderungen nachgeben. Doch hinter den Schlagzeilen verbarg sich eine andere Geschichte.
Japan beispielsweise wurde als ein Land dargestellt, das sich der mächtigen amerikanischen Hand beugt. Medien behaupteten wiederholt, die US-Wirtschaft werde 550 Milliarden Dollar investieren. Doch diese Zahl wurde nie verifiziert. Es wurde keine detaillierte Aufschlüsselung veröffentlicht. Kein öffentliches Dokument bestätigte den Umfang. Tatsächlich fiel die Sache bescheidener aus: Die USA senkten ihre Zölle auf japanische Autos und Autoteile pauschal auf 15 Prozent.
Gleichzeitig blieben die amerikanischen Automobilhersteller in einer Lieferkette gefangen, deren Komponenten mehrfach die Grenzen der USA, Mexikos und Kanadas passieren müssen. Jeder Grenzübergang erhöht die Kosten. Jeder Montageschritt wird besteuert, was diejenigen benachteiligt, die versuchen, die Produktion in Nordamerika zu halten. Das Ergebnis: Ausländische Unternehmen können nun fertig montierte Fahrzeuge zu niedrigeren Zöllen importieren, während die inländische Produktion bewusst teurer wird.
Das ist kein Protektionismus. Es ist Theater. Es belohnt die Illusion von Stärke und untergräbt gleichzeitig genau die Ergebnisse, die es angeblich verteidigen soll.
Der australische Rindfleischdeal verlief ähnlich. Er wurde als großer Erfolg dargestellt – endlich Zugang zu einem wichtigen Exportmarkt. Doch die Veränderung war gering. Australien lockerte langjährige Beschränkungen für US-Rindfleisch, das nach wie vor deutlich teurer ist als einheimisches Rindfleisch. Die Marktgrundlagen änderten sich nicht. Die Nachfrage veränderte sich nicht. Doch der Anschein eines Erfolgs wurde dennoch erweckt, denn die Ankündigung allein reichte aus, um die Illusion aufrechtzuerhalten.
Diese Beispiele sind keine Ausreißer. Sie sind Muster.
Immer wieder wird uns erzählt, die amerikanische Führungsrolle werde wiederhergestellt, die Wirtschaft verteidigt und der Handel neu ausgerichtet. Doch bei genauerem Hinsehen entpuppt sich diese Politik als wiederverwertet, symbolisch oder strukturell wirkungslos. Und jede einzelne dient nicht der Information der Öffentlichkeit, sondern dazu, eine Geschichte des Zusammenbruchs zusammenzufügen.
Der Mythos besagt, dass das System funktioniert, wenn die richtige Person das Sagen hat. Die Realität zeigt jedoch, dass es egal ist, wer am Podium steht, solange die Logik des Systems dieselbe bleibt.
Was wir hier erleben, ist keine Politik, sondern Markenführung.
Das heißt nicht, dass nichts passiert. Es tut sich etwas. Nur nicht in die Richtung, die die meisten Erzählungen suggerieren. Immer mehr Menschen bemerken die Lücken. Immer mehr hinterfragen die Prämisse. Sie sind vielleicht keine Politikexperten, aber sie schauen nicht länger weg. Sie wissen, dass ihre Löhne nicht mit den Preisen steigen. Sie wissen, dass ihre Arbeitsplätze nicht zurückkehren. Sie wissen, dass Slogans weder Mieten senken noch Schulden abbauen oder Stabilität schaffen.
Diese stille Erkenntnis ist machtvoll. Nicht, weil sie direkt zu Revolution oder Reform führt, sondern weil sie das Ende einer bestimmten Art von Vertrauen signalisiert – des Vertrauens in das Spektakel, des Vertrauens in oberflächliche Antworten, des Vertrauens in die Leistung der Führung statt in die Substanz der Regierungsführung.
So sieht die Veränderung aus. Nicht dramatisch. Nicht erklärt. Einfach unbestreitbar.
Die Illusion zerbricht. Und die darauf folgende Stille ist keine Leere. Es ist der Raum, in dem die Menschen beginnen, auf etwas Reales zu lauschen.
++++++++++++++++++++++++++++++++
Wenn sich der Horizont auflöst, sucht man instinktiv zuerst nach einem Kompass. Doch manchmal fehlt auch die Karte. Das Terrain verschiebt sich unter den Füßen. Kategorien verschwimmen. Die alten Unterscheidungen – links und rechts, liberal und illiberal, Reformer und Radikale – beginnen sich performativ anzufühlen. Nicht, weil es nichts mehr auf dem Spiel stünde, sondern weil die Sprache nichts mehr Stabiles mehr andeutet.
Was also tun?
In einem solchen Dickicht gibt es drei Versuchungen.
Die erste ist die Wiederherstellung. So zu tun, als gäbe es die Lichtung noch, wenn wir sie nur wiederfinden könnten. Das sind die Verfahrensliberalen, die Verfassungsoriginalisten, die Mitte-links-Institutionalisten, die glauben, das eigentliche Problem sei populistischer Lärm, nicht strukturelle Entropie. Ihr Glaube ist verfahrensorientiert – und sie sind oft gute Menschen –, aber ihre Metaphysik ist erschöpft.
Die zweite ist der Bruch. Die Landkarte verbrennen. Das ist der Akzelerationist, der Untergangsprophet, der ästhetische Faschist, der Krypto-Nihilist. Diejenigen, die den Zusammenbruch heraufbeschwören, als wäre Zusammenbruch Klarheit. Sie wollen nicht navigieren – sie wollen das Terrain völlig zerstören. Doch Zusammenbruch ist nicht sauber. Er ist Hunger, Feuer, Kindersoldaten. Er reinigt nicht. Er löscht aus.
Der dritte Weg ist Rückzug. In private Tugend, in den Garten, ins kleine Leben. Die Benedikt-Option, die autarke Kommune, der Stadtspaziergang mit Kopfhörern. Darin liegt Schönheit. Aber es ist auch eine Art Hingabe. Und ohne Zeugen kann es zur Gleichgültigkeit führen.
Was bleibt also übrig?
Eine vierte Haltung: Orientierung ohne Illusion.
Mit offenen Augen durch das Dickicht gehen. Erkennen, dass wir zwischen Strukturen leben – dass der Liberalismus als Ordnung im Sterben liegt, der Postliberalismus als Ersatz noch nicht geboren ist und die Rituale, die wir durchführen, Fragmente sind. Diese Wahrheit ist immer noch wichtig, muss aber von der Inszenierung getrennt werden. Diese Schönheit ist real, aber ungleich verteilt. Diese Bedeutung ist schwer – und muss getragen werden, auch wenn niemand zusieht.
Dies ist keine Politik des Sieges. Es ist eine Politik der Geduld. Eine Politik des langsamen Institutionenaufbaus. Eine Politik der Kohärenz statt Charisma. Eine Politik der Verteidigung der Möglichkeit der Wahrheit, ohne sie voreilig einzufordern.
Es bedeutet, sich der Reinheit zu widersetzen. Sich aus Wut der Zugehörigkeit zu widersetzen. Sich der Verführung durch ein Team zu widersetzen.
Es bedeutet, Pluralismus zu fördern, nicht weil jeder Recht hat, sondern weil niemand vollständig ist.
Es bedeutet, Nostalgie und Zynismus gleichzeitig loszulassen.
Weil Nostalgie lügt. Und Zynismus ein Luxusglaube ist.
Die Menschen, die durchhalten – die die kulturellen Bänder über den Zusammenbruch hinwegtragen – sind oft nicht die Lautesten. Sie sind diejenigen, die ohne Applaus aufbauen. Die trotz Spott lehren. Die in stillen Räumen beten. Die Brücken reparieren, über die niemand Gedichte schreibt.
Letztendlich bedeutet das Leben im Dickicht, zu akzeptieren, dass die Klarheit zu unseren Lebzeiten vielleicht nicht zurückkehrt. Aber Kohärenz – lokal, fragil, real – ist immer noch möglich.
Und das könnte genug sein.
Denn aus Zusammenhalt kann Gemeinschaft entstehen.
Und aus der Gemeinschaft, der Kultur.
Und aus der Kultur – wenn der Boden wieder bereit ist – eine Zukunft.